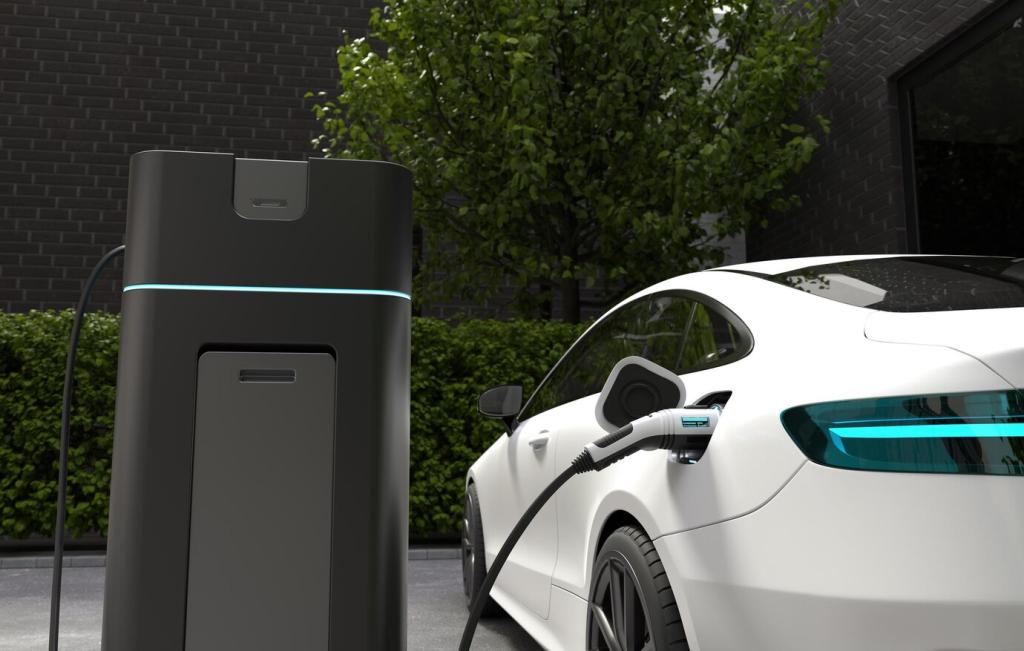This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Zukunftliche Herausforderungen für die Infrastruktur von Elektrofahrzeugen
Die Elektromobilität gewinnt stetig an Bedeutung und stellt zentrale Weichen für die nachhaltige Mobilität der Zukunft. Doch mit dem rapiden Anstieg der Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen entstehen auch neue, weitreichende Herausforderungen für die begleitende Infrastruktur. Themen wie die Erweiterung des Ladenetzes, die Integration erneuerbarer Energien sowie Fragen zur Netzstabilität rücken verstärkt in den Fokus. Um den Wandel erfolgreich zu gestalten, müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft innovative Lösungen entwickeln und kooperativ umsetzen. Auf dieser Seite beleuchten wir die wichtigsten zukünftigen Herausforderungen für die Infrastruktur von Elektrofahrzeugen und geben einen umfassenden Überblick über die entscheidenden Handlungsfelder.
Netzausbau und Versorgungssicherheit